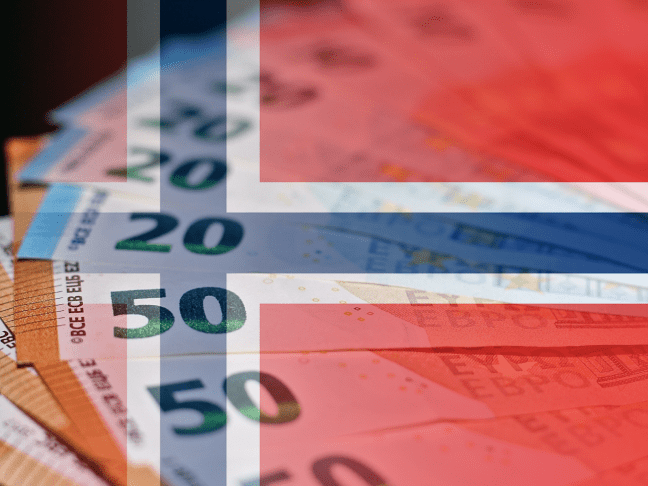Von Alexander Muhr. 
Die Finanzierung religiöser Gemeinschaften in Estland bewegt sich in einem komplexen Spannungsfeld zwischen dem verfassungsrechtlich verankerten Prinzip staatlicher Neutralität gegenüber Religion, den überwiegend privat-zivilen Finanzierungsstrukturen und den nur in begrenztem Umfang vorhandenen staatlichen Unterstützungsmechanismen. Das estnische Religionsrecht sieht keine institutionalisierte Kirchensteuer oder vergleichbare Formen öffentlicher Finanzierung vor. Religiöse Gemeinschaften sind daher in hohem Maße auf Eigenmittel, Spenden und internationale Unterstützung angewiesen.
In Estland sind über 500 religiöse Vereinigungen beim Innenministerium registriert.[1] Dabei ist zu beachten, dass das Ministerium jede Gemeinde einer Kirche oder Religionsgemeinschaft einzeln erfasst. Die römisch-katholische Kirche nimmt innerhalb dieses pluralen und stark säkularisierten Religionssystems eine zahlenmäßig sehr kleine Minderheitenposition ein. Nach Angaben des Annuario Pontificio 2024 zählt die katholische Kirche in Estland bei einer Gesamtbevölkerung von rund 1,39 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern lediglich etwa 6.800 Mitglieder.[2] Damit gehören nur rund 0,5 Prozent der estnischen Bevölkerung der katholischen Kirche an. Ein bedeutsamer institutioneller Entwicklungsschritt erfolgte im September 2024, als Papst Franziskus die bisherige Apostolische Administratur von Estland zur immediaten Diözese Tallinn erhob.[3]
Rechtsrahmen der Kirchenfinanzierung in Estland
Das estnische Verfassungsrecht garantiert die Religionsfreiheit und stellt zugleich das Prinzip der Säkularität klar. Im Artikel 40 der estnischen Verfassung von 1992 heißt es dazu:
„Everyone is entitled to freedom of conscience, freedom of religion and freedom of thought. Everyone is free to belong to any church or any religious society. There is no state church. Everyone is free to practise his or her religion, alone or in community with others, in public or in private, unless this is detrimental to public order, public health or public morality.” [4]
Diese Bestimmung bildet die normative Grundlage dafür, dass der Staat grundsätzlich keine besonderen oder dauerhaften Privilegien zugunsten einzelner Religionsgemeinschaften vorsieht.
Das zentrale Instrument zur Organisation und Rechtsstellung religiöser Gemeinschaften in Estland ist der Kirikute ja koguduste seadus (Churches and Congregations Act),[5] der erstmals im Jahr 2002 erlassen und seither mehrfach novelliert wurde. Dieses Gesetz definiert unter anderem die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Finanzierung, Registrierung religiöser Körperschaften, die Rechtsfähigkeit einzelner Gemeinden, die Vertretungsbefugnisse ihrer Organe sowie die grundlegenden Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften.[6]
Gemäß § 5 Abs. 1 des Gesetzes besitzen Religionsgemeinschaften in Estland grundsätzlich den Status juristischer Personen, auf die ergänzend das Vereinsgesetz (Non-profit Associations Act)[7] Anwendung findet. Damit wird der rechtliche Status religiöser Organisationen im Sinne des Privatrechts festgelegt.[8] Darüber hinaus räumt
§ 25 des Churches and Congregations Act den Kirchen und Religionsgemeinschaften das Recht ein, von ihren Mitgliedern Mitgliedsbeiträge zu erheben, Gebühren für religiöse Riten einzuheben, Spendensammlungen für bestimmte Zwecke zu organisieren, Spenden und Nachlässe anzunehmen sowie Erträge aus dem eigenen Vermögen zu erzielen.[9] Damit verweist die gesetzliche Regelung auf ein im Wesentlichen privatrechtlich-autonomes Finanzierungsmodell, das auf Eigenmitteln und freiwilligen Zuwendungen beruht.
Neben diesen privatrechtlichen Finanzierungsformen bestehen in begrenztem Umfang staatliche oder kommunale Förderinstrumente, die über haushalts-, kultur- oder denkmalpolitische Programme gewährt werden. Ein zentrales Referenzdokument in diesem Zusammenhang ist das Grundsatzpapier Pühakodade säilitamine ja areng („Preservation and Development of Sacred Buildings“), das Möglichkeiten öffentlicher Zuschüsse zur Erhaltung und Entwicklung historisch oder kulturell bedeutsamer Kirchen und Sakralbauten vorsieht.[10]
Für die römisch-katholische Kirche gelten zusätzlich die Bestimmungen des bilateralen Abkommens zwischen der Republik Estland und dem Heiligen Stuhl[11] (Konkordat). Dieses Abkommen verleiht der katholischen Kirche ausdrücklich den Status einer juristischen Person im Sinne des estnischen Zivilrechts[12] und regelt darüber hinaus Fragen des Eigentums, der religiösen Bildung sowie der pastoralen Betreuung in öffentlichen Institutionen wie Schulen, Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen.[13]
Struktur und Quellen der Kirchenfinanzierung
Während die Estnische Evangelisch-Lutherische Kirche und die Estnische Apostolische Orthodoxe Kirche[14] im Jahr 2018 einmalig insgesamt 8,2 Millionen Euro an Direktzahlungen als Ausgleich für Schäden und Zerstörungen infolge des Zweiten Weltkriegs und der sowjetischen Besatzung erhielten,[15] erhält die katholische Kirche in Estland keine direkte oder automatische finanzielle Unterstützung.[16] Die wichtigste Einnahmequelle der katholischen Kirche sind freiwillige Spenden und Kollekten ihrer Mitglieder. Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen verpflichtenden Mitgliedsbeitrag zu erheben, doch wird dieser von der katholischen Kirche in Estland derzeit nicht eingezogen. Daher hängt die finanzielle Stabilität der Kirche maßgeblich von der Spendenbereitschaft der Gläubigen ab. Leider liegen seitens der katholischen Kirche in Estland beziehungsweise der Diözese Tallinn keine umfassenden Berichte über die finanzielle Situation vor.
Abgesehen davon gibt es Begünstigungen und Steuerbefreiungen für religiöse Gemeinschaften. Diese sind jedoch nicht als direkte Förderungen zu verstehen, sondern stellen eine Form indirekter Unterstützung dar. Während solche indirekten Zuschüsse in früheren Zeiten in Form von Steuervergünstigungen vergleichsweise großzügig ausfielen, ist in jüngerer Zeit eine Abkehr von automatischen Vergünstigungen und eine stärkere Gleichstellung zwischen religiösen Gemeinschaften und anderen gemeinnützigen Organisationen zu beobachten. Beispielsweise gibt es seit 2011 keine automatische Befreiung von der Einkommensteuer mehr, wie sie zuvor galt. Vor 2011[17] wurden in Estland registrierte religiöse Vereinigungen automatisch in die Liste der steuerbefreiten Organisationen aufgenommen, während herkömmliche gemeinnützige Organisationen einen entsprechenden Antrag stellen mussten. Mit der Änderung des Einkommenssteuergesetzs 2011[18] wurde ein Kompromiss geschaffen: Alle religiösen Vereinigungen, die am 31. Dezember 2010 bereits in der Liste der steuerbefreiten Organisationen verzeichnet waren, wurden ab dem 1. Januar 2011 automatisch übernommen. Seitdem müssen neu gegründete religiöse Vereinigungen, ebenso wie andere Organisationen, einen Antrag auf Aufnahme in die Liste der steuerbefreiten Organisationen stellen.[19]
Religiöse Vereinigungen genossen bis 2007 bestimmte Privilegien in Bezug auf die Mehrwertsteuer. Diese wurden in der Regel als Vergünstigungen auf den regulären Steuersatz gewährt. So konnten religiöse Organisationen beispielsweise bis zum 1. Juli 2007 Strom zu einem reduzierten Steuersatz von 5 % statt des regulären Satzes von 18 %[20] beziehen. Dieses Privileg galt nicht für andere gemeinnützige Organisationen und besteht heute nicht mehr.[21]
Darüber hinaus sind religiöse Vereinigungen von der Grundsteuer befreit.[22] Die Grundsteuer wird nicht auf Grundstücke erhoben, auf denen Kultstätten von Kirchen und Gemeinden liegen.[23]
Eine weitere Form der zumindest indirekten Kirchenfinanzierung stellen staatliche Mittel zum Erhalt von Kirchen und anderen religiösen Gebäuden dar. Da sakrale Bauwerke in der Regel einen erheblichen historischen, kulturellen und künstlerischen Wert besitzen, ist der Staat verpflichtet, zusätzliche Finanzmittel zur Unterstützung von Kirchen und Religionsgemeinschaften bei der Erhaltung dieser Gebäude bereitzustellen.[24] Die Höhe der bereitgestellten Mittel hängt dabei von den verfügbaren Haushaltsressourcen ab. Am 18. März 2003 verabschiedete die estnische Regierung das bereits eingangs erwähnte Grundsatzpapier Pühakodade säilitamine ja areng (Erhaltung und Entwicklung sakraler Gebäude). Obwohl es sich hierbei nicht um ein Gesetz handelt, bildete das Dokument die Grundlage für eine Reihe finanzieller Maßnahmen zur Förderung und Entwicklung von Kirchen im Zeitraum von 2003 bis 2013. Das Programm wurde später für die Jahre 2014–2018 überarbeitet und fortgeführt. Auf Basis dieses Grundsatzpapiers, das die historische, kulturelle und gemeinschaftliche Bedeutung christlicher Kirchen ausdrücklich anerkannte, wurden jährlich Mittel für die Erhaltung und Renovierung sakraler Gebäude aus dem Staatshaushalt bereitgestellt. Zwischen 2003 und 2013[25] wurden insgesamt 9,23 Millionen Euro für entsprechende Projekte gewährt. Für das Anschlussprogramm 2014–2018 standen 3,6 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt stellte der Staat zwischen 2004 und 2018[26] rund 13 Millionen Euro zur Umsetzung der Programmziele bereit. Da der überwiegende Teil der historisch wertvollen Kirchen im Besitz der Evangelisch-Lutherischen Kirche Estlands sowie der Estnisch-Apostolischen Orthodoxen Kirche liegt, entfiel der größte Anteil der Mittel auf diese beiden Gemeinschaften.[27]
Spenden und Projektunterstützung durch kirchliche Einrichtungen aus dem Ausland
Neben Mitteln aus Spenden und Kollekten der Mitglieder sowie Zuschüssen und Steuererleichterungen der öffentlichen Hand erhält die Katholische Kirche in Estland auch Projektförderungen von anderen kirchlichen Einrichtungen und Stiftungen.
So fördern beispielsweise die kirchliche Stiftung Bonifatiuswerk[28] und der Verein Renovabis[29] seit Jahrzehnten gemeinsam Projekte in Estland. Das Bonifatiuswerk finanzierte in der Vergangenheit vor allem Bauhilfen für verschiedene kirchliche Gebäude in Estland, darüber hinaus aber auch Personalkosten sowie pastorale Projekte.[30] Der Verein Renovabis unterstützt die katholische Kirche in Estland jährlich mit etwa 100.000 Euro. Nach Angaben des Vereins wurden seit 1992 insgesamt rund 3,67 Millionen Euro für die Unterstützung der Kirche in Estland bereitgestellt.[31]
Besoldung der Priester und Angestellten der Katholischen Kirche in Estland
Die Vergütung von Priestern sowie anderer Personen, die für Kirchen oder sonstige Religionsgemeinschaften tätig sind, erfolgt durch die jeweiligen religiösen Organisationen selbst.[32] Militär-, Gefängnis- und Polizeiseelsorger hingegen besitzen den Status von Beamten und werden vollständig aus öffentlichen Haushaltsmitteln finanziert. Die Gefängnisseelsorge untersteht der Koordination des Justizministeriums, während die Militärseelsorge dem Zuständigkeitsbereich des Verteidigungsministeriums zugeordnet ist. Ein institutionell verankertes Seelsorgesystem in Krankenhäusern besteht derzeit nicht. Im Jahr 2007 wurde der Seelsorgedienst innerhalb der estnischen Polizei eingeführt. Zur Ausübung des Seelsorgeamtes sind ausschließlich Personen berechtigt, die einer Kirche angehören, welche Mitglied des Estnischen Kirchenrats[33] ist. Die Seelsorgetätigkeit ist dabei interkonfessionell und ökumenisch ausgerichtet. Die Organisation dieser Seelsorgebereiche beruht gegenwärtig auf einer Kooperationsvereinbarung[34] zwischen dem Estnischen Kirchenrat und dem Staat.[35]
Lehrkräfte für den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen werden aus staatlichen beziehungsweise kommunalen Mitteln vergütet. [36]
Aktuelle Entwicklung – Novellierung des Church Acts
Seit den Jahren 2024/2025 wird in Estland intensiv über die Novellierung des Churches and Congregations Act[37] debattiert, die das Verhältnis zwischen Staat und Religionsgemeinschaften neu zu definieren sucht. Nach offiziellen Angaben verfolgen die geplanten Änderungen das Ziel, den Einfluss ausländischer politischer Akteure über religiöse Organisationen einzuschränken. In der politischen und öffentlichen Diskussion richtete sich der Fokus jedoch vornehmlich auf die Verbindungen der Esnisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriachats.[38]
Das Parlament hat mehrere Fassungen des Gesetzes beraten und in überarbeiteter Form verabschiedet. Präsident Alar Karis hat das Gesetz jedoch bereits zweimal aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken an das Parlament zurückverwiesen und es zuletzt im September 2025 dem Obersten Gerichtshof zur verfassungsrechtlichen Prüfung vorgelegt. Zentrale Streitpunkte betreffen insbesondere die mögliche Verletzung des Grundrechts auf Religionsfreiheit sowie die unbestimmten Formulierungen im Gesetzestext, die staatliche Eingriffe in religiöse Lehren und Organisationsstrukturen ermöglichen könnten.[39]
[1] Siehe dazu die Übersicht des estnischen Innenministeriums aus dem Jahr 2012: Eestis registreeritud usulised ühendused (In Estland registrierte religiöse Vereinigungen), https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2020-12/Eestis%20registreeritud%20usulised%20%C3%BChendused.pdf (Abgerufen, am 22.10.2025); Die Übersicht ist über die Webseite des Innenministeriums unter der Rubrik „Religiöse Angelegenheiten“ Abrufbar: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/usuasjad (Abgerufen, am 22.10.2025).
[2] Vgl. Annuario Pontificio per l‘anno 2024, S. 1217.
[3] Vgl. Presseamt des Hl. Stuhls, Elevation to diocese of the apostolic administration of Estonia, and appointment of first bishop, Estonia, in: Tägliches Bulletin vom 26. September 2024, https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2024/09/26/240926b.html (Abgerufen, am 21.10.2025).
[4] § 40 Eesti Vabariigi põhiseadus (The Constitution of the Republic of Estonia), RT 1992, 26, 349, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521052015001/consolide?utm (Abgerufen, am 21.10.2025).
[5] Kirikute ja koguduste seadus (Churches and Congregations Act), RT I 2002, 24, 135, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511012018004/consolide?utm (Abgerufen, am 21.10.2025).
[6] Vgl. §§ 1, 5, 13, 24, 25, 26 und 27 Churches and Congregation Act.
[7] Mittetulundusühingute seadus (Non-profit Associations Act) RT I 1996, 42, 811, https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510042014003/consolide (Abgerufen, am 21.10.2025).
[8] Churches and Congregations Act § 3
[9] Ebd. § 25
[10] Vgl. Kiviorg, Merilin, Financing of Religious Communities in Estonia, in: Brigitte Basdevant-Gaudemet, Salvatore Berlingó (Hg.), The Financing of Religious Communities in the European Union, Leuven 2009, S. 138f.
[11] Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vaheline kokkulepe katoliku kiriku õigusliku staatuse kohta Eesti Vabariigis (Abkommen zwischen der Republik Estland und dem Heiligen Stuhl über die Rechtsstellung der katholischen Kirche in der Republik Estland), RT II 1999, 7, 47, https://www.riigiteataja.ee/akt/79173 (Abgerufen, am 21.10.2025).
[12] Vgl. Ebd. Art. 2.
[13] Vgl. Ebd. Art. 2, 7 und 9.
[14] Anm.: In Estland gibt es aus historischen Gründen zwei orthodoxe Kirchen. Einerseits existiert die Estnische Apostolische Orthodoxe Kirche, die unter dem Ökumenischen Patriarchat steht, und andererseits die Estnisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats. Einer Statistik des estnischen Innenministeriums aus dem Jahr 2013 zufolge zählt die Estnische Apostolische Orthodoxe Kirche rund 27.000 Mitglieder und die Estnisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats rund 170.000 Mitglieder. Vgl. Statistische Daten des estnischen Innenministeriums, https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2020-12/Statistilisi%20andmeid%20vaimulike%20kohta.pdf (Abgerufen, am 22.10.2025); Die Übersicht ist über die Webseite des Innenministeriums unter der Rubrik „Religiöse Angelegenheiten“ Abrufbar: https://www.siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/sidus-uhiskond/usuasjad (Abgerufen, am 22.10.2025).
Für weitere Informationen zur Orthodoxie in Estland: Laitinen, Aappo, Die orthodoxen Kirchen Finnlands und Estlands, in: Thomas Bremer, Hacik Rafi Gazer, Christian Lange (Hgg.), Die orthodoxen Kirchen der byzantinischen Tradition, Darmstadt 2013, S. 101-106.
[15] Vgl. Vahtla, Aili, Estonian government supports legalizing damages compensation to churches, in news.err (05.04.2018), https://news.err.ee/694209/estonian-government-supports-legalizing-damages-compensation-to-churches (Abgerufen, am 17.10.2025). Anm.: Der Eesti Rahvusringhääling (ERR) ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Estland.
[16] Vgl. Kiviorg, Merilin, Religion and Law in Estonia. Third Edition, Alphen aan den Rijn, 2021, S. 124.
[17] Siehe dazu den Gesetzestext, der bis 2011 gültig war: § 11 Income Tax Act (Tulumaksuseadus) RT I 1999, 101, 903, https://www.riigiteataja.ee/akt/78069 (Abgerufen, am 21.10.2025).
[18] Siehe dazu: Income Tax Act (Tulumaksuseadus) RT I, 23.12.2013, 23, https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013023 (Abgerufen, am 21.10.2025).
[19] Vgl. Kiviorg, Religion and Law in Estonia, 2021, S. 125.
[20] Siehe dazu das estnische Mehrwertsteuergesetz: Value Added Tax Act (Käibemaksuseadus) RT I 2001, 64, 368, https://www.riigiteataja.ee/akt/603989 (Abgerufen, am 21.10.2025).
[21] Vgl. Kiviorg, Religion and Law in Estonia, 2021, S. 126.
[22] Siehe dazu: § 4 Abs. 5 Land Tax Act (Maamaksuseadus) RT I 1993, 24, 428, https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaMS (Abgerufen, am 31.10.2025).
[23] Vgl. Kiviorg, Religion and Law in Estonia, 2021, S. 126.
[24] Siehe dazu: Heritage Conservation Act (Muinsuskaitseseadus) aus 2002 (bis 2019 gültig), RT I 2002, 27, 153, https://www.riigiteataja.ee/akt/27815 (Abgerufen, am 22.10.2025). In Verbindung mit dem Heritage Conservation Act (Muinsuskaitseseadus) aus 2019, RT I, 19.03.2019, 13, https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019013 (Abgerufen, am 22.10.2025).
[25] Vgl. Estnische Denkmalschutzbehörde (Muinsuskaitseamet), Erhaltung und Entwicklung von Kultstätten Nationales Programm 2003–2013, Tallinn 2013, S. 11, https://muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-02/Pühakodade säilitamine ja areng_Riiklik progamm 2003 kuni 2013.pdf? (Zugriff, am 17.10.2025).
[26] Vgl. Estnische Denkmalschutzbehörde (Muinsuskaitseamet), Erhaltung und Entwicklung von Kultstätten Nationales Programm 2014–2018, Tallinn 2019, S. 18, https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/documents/2024-02/Raamat_Puhakodade%20sailitamine%20ja%20areng%202014-2018_v.pdf (Zugriff, am 17.10.2025).
[27] Vgl. Kiviorg, Religion and Law in Estonia, 2021, S. 126f.
[28] Siehe dazu den Onlineauftritt des Bonifatiuswerk und dort die Übersicht über die geförderten Projekte in Estland: https://www.bonifatiuswerk.de/de/projekte/estland (Zugriff, am 17.10.2025).
[29] Siehe dazu die Übersichtsseite des Vereins Renovabis: https://www.renovabis.de/laender/baltikum/estland/#projektfoerderung (Zugriff, am 17.10.2025).
[30] Vgl. Nowak, Markus, Katholisch im Baltikum. Estland und Lettland – Facetten einer Diasporakirche, Paderborn 2024, S. 73-75.
[31] Vgl. Ebd. S. 78.
[32] Vgl. Kiviorg, Religion and Law in Estonia, 2021, S. 130.
[33] Anm. Der Estnische Kirchenrat wurde am 16. Februar 1989 gegründet und besteht aus zehn christlichen Kirchen, darunter die beiden größten Kirchen Estlands – die Evangelisch-Lutherische Kirche und die Estnisch-Apostolisch-Orthodoxe Kirche, aber auch die wesentlich kleinere Katholische Kirche in Estland ist Mitglied. Er koordiniert die Zusammenarbeit der Kirchen untereinander sowie die Zusammenarbeit mit dem estnischen Staat. Siehe dazu: Offizielle Webseite des estnischen Kirchenrats: https://ekn.ee/ (Zugriff, am 20.10.2025).
[34] Protokoll über gemeinsame Interessen zwischen der Regierung der Republik Estland und dem Estnischen Kirchenrat vom 17. Oktober 2002, https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/documents/2021-10/eesti_vabariigi_valitsuse_ja_eesti_kirikute_noukogu_uhishuvide_protokoll.pdf (Zugriff, am 20.10.2025).
[35] Vgl. Kiviorg, Religion and Law in Estonia, 2021, S. 130.
[36] Vgl. Kiviorg, Merilin, State and Church in Estonia, in: Gerhard Robbers (Hg.), State and Church in the European Union, Baden-Baden 2019, S. 141.
[37] Siehe dazu: Stand der Beratung zur geplanten Änderung des Gesetzes auf der Webseite des estnischen Parlaments: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/133fc804-5a56-46f8-b595-84cc2a66465f/kirikute-ja-koguduste-seaduse-muutmise-seaduse-eelnou-570-ua/ (Zugriff, am 20.10.2025). Bzw. die Veröffentlichung des estnischen Innenministeriums zum geplanten Gesetz: https://www.siseministeerium.ee/kirikute-ja-koguduste-seaduse-muudatus (Abgerufen, am 22.10.2025).
[38] Vgl. Pressemitteilungen des estnischen Parlaments vom 18. Juni 2025, https://www.riigikogu.ee/pressiteated/oiguskomisjon-et-et/riigikogu-kiitis-heaks-uuenenud-kirikute-ja-koguduste-seaduse-muudatused (Zugriff, am 20.10.2025).
[39] Vgl. Krjukov, Aleksander; Turovski, Marcus, President takes controversial church law amendments to Supreme Court, in news.err.ee (03.10.2025), https://news.err.ee/1609819758/president-takes-controversial-church-law-amendments-to-supreme-court (Abgerufen, am 20.10.2025).