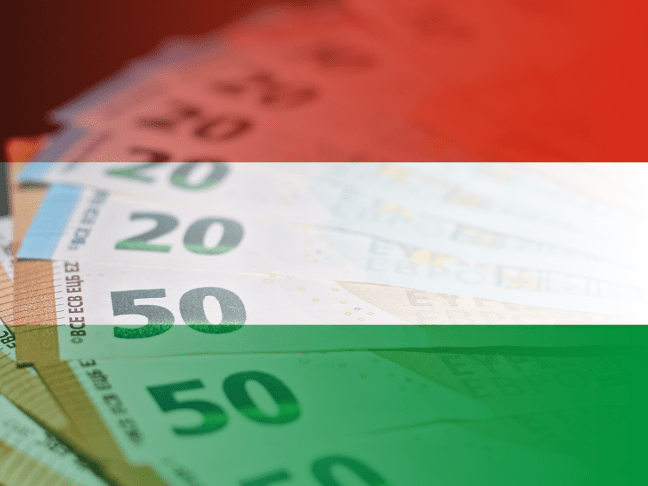Von Andreas Kowatsch. 
DOI: 10.25365/phaidra.666
Am 24. Oktober 2024 unternahmen die bevollmächtigten Vertreter der Tschechischen Republik und des Heiligen Stuhles einen zweiten Anlauf, das Verhältnis von Katholischer Kirche und dem tschechischen Staat rechtlich zu ordnen. Nach dem grünen Licht des Senats und der anschließenden Genehmigung im Abgeordnetenhaus im März 2025 steht der Ratifikation eines neuen Grundlagenvertrags, der dem nicht immer spannungsfreien Verhältnis zwischen Kirche und Staat eine neue rechtliche Grundlage geben soll, nichts mehr im Weg.[*]
Bereits im Jahr 2002 war ein erster schon unterzeichneter Vertrag vom tschechischen Parlament nicht genehmigt worden. Auch der parlamentarischen Genehmigung des aktuellen Vertrages gingen leidenschaftlich geführte Debatten voraus. Diese drehten sich inhaltlich hauptsächlich um die Kritik am staatlichen Schutz des Beichtgeheimnisses (im Land des heiligen Johannes Nepomuk!), waren in Wahrheit aber wohl auch Auswirkungen eines mitunter ideologisch überhitzten Konflikts um die Neuordnung des Verhältnisses des demokratischen Staates gegenüber den von den Kommunisten enteigneten, gesellschaftlich marginalisierten und mitunter auch heftigen Repressalien ausgesetzten Religionsgemeinschaften.
1. Gesellschaftlicher Hintergrund
Die Millionen Menschen, die jedes Jahr die Tschechische Republik besuchen und nicht nur die Hauptstadt Prag zu einem der wichtigsten Hotspots des internationalen Tourismus machen, gewinnen angesichts der zahllosen Kirchen und christlichen Baudenkmäler sicherlich nicht selten den Eindruck, ein mehrheitlich christliches Land zu bereisen. Dieser Anschein spiegelt die tatsächliche religionssoziologische Situation aber nicht adäquat wider. Das Verhältnis der Tschechen zur Religion wird vielfach als ambivalent beschrieben. Die „Gegenreformation“ und die enge Verflechtung der Katholischen Kirche mit dem österreichischen Herrscherhaus haben die religiöse und kulturelle Landschaft Tschechiens nachhaltig beeinflusst. Vor allem aber war es der kommunistische Staatsatheismus, der mit wenigen zeitlichen Atempausen die Katholische Kirche an ihrer Sendung behinderte und teilweise auch brutal verfolgte, welcher bis heute vor allem in West- und Nordböhmen Narben hinterlassen hat.
Beim letzten Zensus 2011[1] bekannten sich nur mehr knapp über zehn Prozent der Tschechen zum katholischen Glauben. Andere christliche Konfessionen sind im Land präsent, allerdings in einer verschwindend geringen Anzahl an Gläubigen gemessen an der Gesamtbevölkerung. Zum Islam bekennt sich im Gegensatz zu den meisten westeuropäischen Ländern ebenfalls nur ein sehr kleiner Anteil der Bürger. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass knapp 45 Prozent der beim Zensus Erfassten keine Angaben zum Religionsbekenntnis gemacht hat. Die Vermutung, dass die oftmals gehörte Diagnose, Tschechien sei eines der am stärksten säkularisierten Länder Europas, zu oberflächlich ist, belegen die Zahlen der Tschechischen Bischofskonferenz. Noch ca. 37 Prozent der Bevölkerung sind demnach katholisch getauft. Die hohe Anzahl der Nichtdeklarierten könnte sich daher vielleicht auch mit der Scheu, ausgerechnet dem Staat die eigene Religion zu offenbaren, erklären.
2. Die (Vor-)Frage der Restitution enteigneter Kirchengüter
Tschechien ist das letzte Land in Mitteleuropa, das nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein Konkordat[2] geschlossen hat.[3] Ursächlich dafür dürfte eine Gemengelage an verschiedenen Faktoren sein, welche zu beurteilen dem österreichischen Religionsrechtler nicht immer ansteht. Feststehen dürfte, dass die Spannungen sich nicht nur um technische Einzelheiten des Staat-Kirche-Verhältnisses drehen, sondern verschiedene Standpunkte zur Aufarbeitung der kommunistischen Zeit berücksichtigt werden müssen. Am augenscheinlichsten lässt sich diese Spannung an den politischen Debatten um die Frage der Restitution von staatlich enteigneten Gütern, welche die Lebensgrundlage vieler Einrichtungen der Katholischen Kirche bildeten, beobachten. Dabei handelt es sich teilweise um Güter, die bereits von den Nationalsozialisten enteignet wurden und später beim kommunistischen Staat verblieben – mitunter unter dem Vorwand, die Eigentümer hätten mit den Nationalsozialisten kollaboriert. Vor allem aber handelt es sich um Vermögen, dass nach 1948 von den Kommunisten verstaatlicht wurde. Zusammen mit diesen Enteignungen wurden Klöster aufgelöst, Religiosen zur Zwangsarbeit verpflichtet, konfessionelle Einrichtungen zerschlagen und die Mehrzahl der Bischöfe verhaftet und interniert. Eine rechtlich verlässliche Lösung der Vermögensfragen war daher aus kirchlicher Sicht nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen Voraussetzung für ein stabiles Fundament der zukünftigen Beziehungen.
Nach langen Verhandlungen und einem Urteil des tschechischen Verfassungsgerichts 2010 wurde die Vermögensfrage im Jahr 2012 durch das Gesetz Nr. 428/2012 über den Vermögensausgleich mit den Kirchen rechtlich gelöst. Das Verfassungsgericht bestätigte 2013 das Gesetz in den wichtigsten Punkten. Neben der physischen Restitution von Gebäuden und Grund und Boden, die sich im direkten Staatsbesitz befanden, erhalten die betroffenen Kirchen – auf Antrag und nach einem mitunter mühsamen Verfahren – eine auf 30 Jahre verteilte Auszahlung einer Entschädigung für nicht restituierte oder beschädigte Kirchengüter. Bis 2030 erfolgt zudem eine betragsmäßig immer weiter abnehmende Subventionierung in Fortführung des Status Quo vor 2012. Vielfach ungeklärt bleibt vielfach die Frage des Umgangs mit ehemaligen Kirchengütern, die sich im Besitz der Gemeinden oder Privater befinden.
Der erzielte Kompromiss war innerkirchlich nicht unumstritten, da einerseits keine vollständige Restitution der enteigneten Vermögenswerte geleistet werden sollte, andererseits auf die historischen Rechtsansprüche einzelner Ordensgemeinschaften zu wenig Rücksicht genommen wurde. Noch viel stärkeren Widerstand erfuhr das Gesetz aber durch die Kommunistische Partei. Gemeinsam mit der Partei ANO und der Sozialdemokratie brachte sie 2019 einen Gesetzesentwurf erfolgreich durch das Abgeordnetenhaus, welcher eine Besteuerung der Wiedergutmachungszahlungen vorsah. Man wollte also, um es etwas polemisch zuzuspitzen, den Bestohlenen dazu zwingen, Steuern auf das zurückgegebene Diebesgut zu bezahlen. Etliche Abgeordnete des Senats fochten das Gesetz jedoch vor dem Verfassungsgericht an, welches noch im selben Jahr die Verfassungswidrigkeit dieses Vorhabens feststellte.
Die 2012 erzielte Lösung führt zu einer schrittweisen Trennung von Kirche und Staat in Vermögensangelegenheiten, welche 2043 vollständig erreicht sein wird. Der neue Grundlagenvertrag mit dem Heiligen Stuhl nimmt in seiner Präambel explizit auf das Gesetz 428/2012 Bezug, wodurch die vermögensrechtlichen Fragen wenigstens auf kirchlicher Seite als gelöst gelten.[4]
3. Der neue Grundlagenvertrag
Die Präambel des neuen Vertrages verweist auf die „jahrhundertealte Tradition der Beziehungen zwischen dem tschechischen Staat und der katholischen Kirche“. Deren Anpassung liege im Interesse beider Seiten. Im Blick auf die Katholische Kirche wird ihre „Verpflichtung zur Förderung des Gemeinwohls, insbesondere zum Schutz der geistigen, menschlichen und kulturellen Werte“ und ihr „Engagement für die Förderung und Entwicklung des ökumenischen und interreligiösen Dialogs“ angesprochen. Staat und Kirche wollen sich „von den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts leiten lassen, insbesondere denjenigen, die sich auf die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten beziehen“. Mit Blick auf den Staat wird die religiös-weltanschauliche Neutralität Tschechiens hervorgehoben. Die Republik und ihr Rechtssystem sind „an keine exklusive Ideologie oder religiöses Bekenntnis gebunden“. Die Bindung des Heiligen Stuhls an die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils und die Regeln des kanonischen Rechts wird anerkannt. Beide Vertragsparteien bringen schließlich „ihren gemeinsamen Willen zur Förderung einer nutzbringenden Zusammenarbeit zum Ausdruck.“
Weder formal noch materiell betrachtet, handelt es sich beim Vertrag um ein Konkordat im eigentlichen Sinn. Als Konkordat werden in der kirchlichen Rechts- und Vertragspraxis nur feierlich abgeschlossene und umfassende Regelungen des Verhältnisses zwischen Katholischer Kirche und dem jeweiligen Staat bezeichnet. Der vorliegende Vertrag regelt zwar keine isolierte Spezialfrage, sondern bildet die Grundlage des zukünftigen Miteinanders. Allerdings wird die Regelung vieler Einzelfragen zukünftigen Gesetzen überlassen und somit in die Hand des staatlichen Vertragspartners gelegt. Daher ist es korrekter, von einem „Grundlagenvertrag“ zu sprechen.
Verbindendes Kennzeichen der zeitgenössischen Konkordate ist, dass diese nicht mehr in erster Linie das Verhältnis zweier in ihrem eigenen Bereich souveräner Institutionen und damit das korporative Verhältnis von Staat und der Katholischen Kirche regeln. Zwar sind institutionelle Fragen nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil aller Staat-Kirche-Verträge, diese dienen jedoch in erster Linie dem Schutz der Religionsfreiheit. Wo der Heilige Stuhl als Völkerrechtssubjekt Verträge mit den Staaten schließt, geht es daher neben der Sicherung der ungehinderten Glaubenspraxis der Katholiken immer auch um ein anwaltschaftliches Eintreten für die Freiheit der anderen Bekenntnisse und ihrer Gläubigen.
4. Einzelne Vertragsinhalte
a) Bekenntnis zur umfassenden Religionsfreiheit
Ganz in diesem Sinn ist Art. 1 Vertrag zu verstehen, der die in Tschechien bereits verfassungs- und völkerrechtlich garantierte Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit normiert. Diese umfasst als negative Religionsfreiheit auch das Recht des Religionswechsels bzw. keinem Bekenntnis anzugehören. Positiv geschützt sind die „Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Gottesdienstbesuch, Religionsausübung, Unterricht und karitative Tätigkeiten zu bekennen.“ Art. 1 Abs. 2 Vertrag enthält eine Schrankenregelung, die in ihrer Formulierung eng an Art. 9 Abs. 2 EMRK angelehnt ist. Insgesamt fällt auf, dass es nicht nur um die Religionsfreiheit der Katholiken geht und auch nicht bloß um eine vertragliche Sicherstellung, dass auch diese vor dem Staat ihre Religion aufgeben können.
b) Rechtspersönlichkeit im staatlichen Recht
Eine klassische Konkordatsmaterie ist die Frage, welche Rechtspersönlichkeit die Kirche in der staatlichen Rechtsordnung genießt. Art. 2 Abs. 1 Vertrag normiert lediglich die Tatsache, dass die Kirche in Tschechien über eine staatlich anerkannte Rechtspersönlichkeit verfügt. Wie diese zu qualifizieren ist, und welche Rechtswirkungen mit ihr verbunden sind, wird aber nicht geregelt, sondern auf die tschechische Rechtsordnung verwiesen.[5]
Eng mit der Frage der Rechtspersönlichkeit der Kirche als solcher verbunden ist die Frage der Rechts- und Handlungsfähigkeit kirchlicher Einrichtungen. Art. 6 Vertrag anerkennt das Recht der Kirche, juristische Personen kirchlichen Rechts zu gründen. Diese erlangen „nach Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen auch die Rechtspersönlichkeit im Sinne der Rechtsordnung der Tschechischen Republik“. Sie sind verpflichtet, „bei ihrer Tätigkeit die Rechtsordnung der Tschechischen Republik einzuhalten.“ Auf welche Weise die staatliche Anerkennung erfolgt, also ob zum Beispiel (wie in Österreich) eine Anzeige bei der staatlichen Behörde erforderlich ist oder ein Genehmigungsverfahren durchlaufen werden muss, ist hier im Grundlagenvertrag nicht geregelt.
c) kirchliches Selbstbestimmungsrecht, insb. Ämterfreiheit
Bereits im Bekenntnis zur Religionsfreiheit ist ein Kernbereich des korporativen Selbstbestimmungsrechts der Kirche mit enthalten. Art. 2 Abs. 3 Vertrag führt dies näher aus und stellt klar, dass insbesondere die sogenannte „Ämterfreiheit“ geschützt ist. Die Kirche „erfüllt ihren Auftrag und verwaltet ihre Angelegenheiten nach ihren eigenen Regeln, insbesondere durch die Einrichtung, Änderung oder Abschaffung ihrer Organe und internen Strukturen; sie wählt, ernennt und entlässt ihren Klerus und andere unmittelbar an der Seelsorge beteiligte Personen unabhängig von den staatlichen Behörden“
d) kirchliche Verfassungseinrichtungen
Fragen der Errichtung und Veränderung von Diözesen und sonstigen kirchlichen Grundeinrichtungen sind eine weitere klassische Vertragsmaterie. In Art. 2 Abs. 2 Vertrag verpflichtet sich die Kirche dazu, dass ihre territorialen Teilkirchen (lateinische und orientalische) sich nur innerhalb des Staatsgebietes befinden.[6]
e) Seelsorgsgeheimnis
Wie oben bereits angedeutet, wurde der Vertrag vor der Genehmigung durch das Abgeordnetenhaus zum Gegenstand einer gesellschaftlichen Debatte, die sich vor allem an der Formulierung des Art. 4 über die Vertraulichkeit und das Seelsorgsgeheimnis entzündete. Vertreter von Opfern sexueller Gewalt in kirchlichem Kontext befürchteten die Möglichkeit der Vertuschung von Verbrechen. Politische Gegner der Kirche kritisierten, dass in Art. 4 Abs. 2 Vertrag nicht vom Beichtgeheimnis und dem Priester, sondern umfassend von den in der Seelsorge Tätigen die Rede sei. Damit allerdings nimmt der Vertrag eine religionsfreiheitsfreundliche Perspektive ein, welche in den meisten freiheitlichen Demokratien üblich ist. Das Seelsorgsgeheimnis wird allerdings nicht absolut garantiert. Zum einen soll es nur „unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen“ gelten, zum anderen entspricht es inhaltlich der auch in anderen beruflichen Kontexten geregelten Schweigepflicht.
f) Anerkennung der kirchlichen Eheschließung
Auch wenn es in Österreich und Deutschland angesichts der seit vielen Jahrzehnten geltenden – ursprünglich gegen erbitterten kirchlichen Widerstand eingeführten – und lange auch strafbewehrten obligatorischen Zivilehe heute auch unter Gläubigen vielfach nicht mehr als Eingriff in die Religionsfreiheit wahrgenommen wird, wenn der Staat die kirchliche Eheschließung nicht wenigstens als Option auch für seinen Bereich anerkennt, hat diese Frage einen fixen Platz in den zeitgenössischen Verträgen. Kirchliches Ideal ist die Anerkennung der nach dem kanonischen Recht geschlossenen Ehe im staatlichen Recht. Die Ehe ist nach dem kirchlichen Selbstverständnis auch eine religiöse Wirklichkeit. Für deren zivile Rechtswirkungen ist der Staat zuständig. Die Ehe als solche ist aber dieselbe im kirchlichen wie im staatlichen Bereich. Sie kann daher nur einmal geschlossen werden, nicht einmal vor dem Staat und einmal in der Kirche. Art. 5 Vertrag kommt der Kirche in dieser Frage weit entgegen, indem die Geltung der kirchlichen Ehen mit der „gleichen Gültigkeit und den gleichen Rechtsfolgen wie eine zivile Eheschließung“ anerkannt wird. Zugleich wird ein Vorbehalt für das staatliche Recht gesetzt, das die Voraussetzungen für diese Anerkennung normieren muss.
g) Kulturgüterschutz
Angesichts des reichen kulturellen Erbes, das durch das Wirken der Katholischen Kirche bis heute Tschechien prägt, ist ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit zum Schutz des von Staat und Kirche geteilten Erbes keine Überraschung. Art. 7 Vertrag enthält im Vergleich zu den vorstehenden Bestimmungen auch ins Detail gehende Regelungen, etwa über die Errichtung einer kirchlichen Kommission. Das Kulturerbe soll möglichst allen zugänglich gemacht werden, freilich unter den von den zuständigen kirchlichen Organen festgesetzten Bedingungen. Art. 7 Abs. 5 betont, dass die kirchlichen Eigentümer von kulturell wertvollen Artefakten in gleichem Maße öffentliche Unterstützungen erhalten können wie andere.
h) Seelsorge in sozialen Einrichtungen und Krankenhäusern
Die Normierung der Bedingungen, unter denen die Kirche ihre Seelsorgsdienste in „Anstaltssituationen“ erbringen kann, zählt aufgrund einer Vielzahl von mitunter gegenläufigen Interessen, die in besonderen Einrichtungen aufeinandertreffen können, zu den wichtigsten Fragen im Staatskirchenvertragsrecht.
Art. 8 Vertrag widmet sich der Seelsorge in sozialen Einrichtungen. In Abs. 1 wird das Recht aller Personen, nicht bloß der Katholiken, in diesen Einrichtungen garantiert, von den katholischen Geistlichen und Seelsorger „geistliche und seelsorgerische Betreuung“ zu erhalten. Der Empfang und die Ausübung der Seelsorge sind daher primär personenzentriert garantiert und nicht unmittelbar vom Religionsbekenntnis abhängig. Es handelt sich vorrangig um ein Recht der Person, nicht um ein Freiheitsrecht der Kirche. Letzteres ist freilich zur tatsächlichen Ausübung der Seelsorge notwendig.
Art. 8 Abs. 2 Vertrag anerkennt das Recht kirchlicher Rechtsträger, „in der Tschechischen Republik und im Ausland soziale, karitative und humanitäre Hilfe zu leisten, und zwar, wenn sie es für zweckmäßig halten, in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen und nichtstaatlichen Organisationen.“
Die soziale Tätigkeit entfaltet sich innerhalb des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts. Art. 8 Abs. 3 Vertrag garantiert das Recht kirchlicher Rechtsträger, sich eigene Statuten zu geben. Die Verbindung zur Kirche kommt auch darin zum Ausdruck, dass sie – in österreichischer Terminologie – Tendenzbetriebe bilden, die „nach den moralischen Grundsätzen und Vorschriften der katholischen Kirche verwaltet“ werden. Diese haben unter den gleichen Voraussetzungen wie Einrichtungen in nichtkirchlicher Trägerschaft Zugang zu öffentlicher Finanzierung der erbrachten Leistungen (Abs. 4).
Schließlich verweist Art. 8 Abs. 5 ausdrücklich auf die Möglichkeit, die Seelsorge mit den Gegebenheiten vor Ort zu koordinieren, indem Vereinbarungen „zwischen der zuständigen kirchlichen Behörde und dem zuständigen Träger der Sozialfürsorge oder der zuständigen staatlichen Behörde“ getroffen werden.
Art. 9 Vertrag über die Seelsorge in den Krankenhäusern ist nach demselben Schema formuliert wie Art. 8. Sein Abs. 1 stellt das Recht aller Personen in den Krankenhäusern heraus, Leistungen der spiritual care durch katholische Seelsorger zu empfangen. Abs. 2 garantiert das Recht der Kirche, „Einrichtungen des Gesundheitswesens nach den in der Rechtsordnung der Tschechischen Republik festgelegten Bedingungen und nach den moralischen Grundsätzen und Vorschriften der katholischen Kirche“ zu unterhalten. Abs. 3 ermöglicht weitergehende einvernehmliche Regelungen. Im Gegensatz zu Art. 8 Vertrag fehlt allerdings eine explizite Bestimmung über den gleichen Zugang zu öffentlichen Finanzierungen und Förderungen.
i) Gefängnisseelsorge
Die Verhängung einer Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßnahme führt nicht dazu, dass dem Strafgefangenen bzw. dem Untergebrachten das Grundrecht auf Religionsausübung und der Zugang zu religiöser Betreuung entzogen würden. Auch (demokratische) Staaten mit einer laizistischen Trennung von Religion und Staat ermöglichen auf die eine oder andere Weise den Zugang der Seelsorger zu den Gefangenen und normieren dafür bestimmte Regelungen.
Art. 10 Vertrag ist ähnlich formuliert wie die beiden unmittelbar voranstehenden Artikel. Abs. 1 garantiert das Recht aller Personen „in Gefängnissen, Haftanstalten und anderen Einrichtungen ähnlicher Art … von der katholischen Kirche geistlich und seelsorgerisch betreut zu werden.“ Auf kirchlicher Seite ist hier nicht der einzelne Seelsorger, sondern die Kirche selbst angesprochen. Kirchliche Stellen können, so Abs. 2, „bei der Erbringung von Bewährungs-, Vermittlungs- und ähnlichen Dienstleistungen“ tätig werden. Auch Art. 10 sieht in Abs. 3 die Möglichkeit der einvernehmlichen Ausgestaltung von Einzelfragen vor.
j) Militärseelsorge
Als letzter Bereich der „Anstaltsseelsorge“ greift Art. 11 Vertrag die Seelsorge für Angehörige der Streitkräfte auf. Abs. 1 spricht vom „Geistlichen Dienst der Armee“ und setzt daher die bereits existierenden Strukturen der Militärseelsorge voraus.[7] Anders als die Art. 7-10 Vertrag wird hier ausdrücklich betont, dass die Seelsorge nur gegenüber jenen Personen, die dies wünschen, ausgeübt wird. Dies gilt auch für die Seelsorge in sozialen Einrichtungen, Spitälern und Gefängnissen, ist aber innerhalb der Befehlsstrukturen des Militärs von besonderer Bedeutung für die Garantie der negativen Religionsfreiheit. Über die grundsätzliche Garantie der Militärseelsorge hinaus verweist auch Art. 11 Abs. 2 noch auf die Möglichkeit der einvernehmlichen Regelung genauerer Bedingungen und reiht sich damit in die Kette der anderen Normen über die Anstaltsseelsorge ein.
Ergänzt wird dieser Bereich noch um die Möglichkeit der Polizeiseelsorge. Voraussetzung dafür ist gem. Art. 12 Abs. 1 Vertrag jedoch ein „Ersuchen der zuständigen Behörde eines Sicherheitskorps“. Auch hier ergänzt Abs. 2 die Möglichkeit weitergehender einvernehmlicher Regelungen außerhalb des Vertrags.
k) Durchführungs- und Schlussbestimmungen
Wenn in mehreren Vertragsbestimmungen auf die Möglichkeit weitergehender einvernehmlicher Regelungen verwiesen wird, stellt sich die Frage, wer über die konkrete Ausgestaltung der vertraglich geregelten Gebiete miteinander in Verhandlung treten soll. Art. 13 Abs. 1 Vertrag ermächtigt die Tschechische Bischofskonferenz, mit den zentralen Verwaltungsbehörden der Tschechischen Republik in allen Angelegenheiten Verhandlungen zu führen, die die gesamte Katholische Kirche in der Tschechischen Republik betreffen. Sofern verbindliche Vereinbarungen getroffen werden sollen, sieht Abs. 2 ein Zustimmungsrecht des Heiligen Stuhls vor. Die Zustimmung kann auch im Vorhinein erteilt werden.
Anders als in Österreich schließt der tschechische Staat mit einzelnen Religionsgemeinschaften aber auch mit Dachverbänden wie dem Ökumenischen Rat der Kirchen Vereinbarungen, um bestimmte gemeinsame Interessen zu koordinieren. Diese Praxis soll durch den Grundlagenvertrag mit der Katholischen Kirche nicht berührt werden. Schließlich hält Art 13 Abs. 1 fest, dass die Republik und der Heilige Stuhl als Vertragspartner immer das Recht haben, in direkte Verhandlungen zu treten.
Keine Regelung enthält der Vertrag für Angelegenheiten, die nicht den Gesamtstaat betreffen. Wo die Einzelbestimmungen des Vertrages einvernehmliche Lösungen durch die zuständigen Organe der Kirche und des Staates vorsehen, richtet sich die Zuständigkeit der kirchlichen Organe nach dem kirchlichen Recht, wobei dem Diözesanbischof in vielen Fällen eine besondere Verantwortung zufallen dürfte. Auf staatlicher Seite richten sich die Zuständigkeiten nach dem tschechischen Recht.
Der Grundlagenvertrag unterliegt den allgemeinen Normen des Völkervertragsrechts. Art. 14 Vertrag sieht vor, dass „Streitigkeiten über die Auslegung oder Durchführung durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien auf diplomatischem Wege beigelegt“ werden. Eine Änderung oder Ergänzung ist nur schriftlich möglich und bedarf gem. Art. 15 Vertrag jeweils des gegenseitigen Einvernehmens.
Der Grundlagenvertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen. Art. 16 Vertrag sieht zwar ein allgemeines Kündigungsrecht für jede Partei vor. Vorrang vor einer Kündigung hat aber die Verpflichtung auf die Herstellung einer möglichst einvernehmlichen Lösung.
4. Würdigung
Der Grundlagenvertrag zwischen der Republik Tschechien und dem Heiligen Stuhl eröffnet für das nicht immer einfache, mitunter auch konfliktbeladene Verhältnis zwischen Tschechien und der Katholischen Kirche die Möglichkeit einer echten Neubestimmung des Miteinanders. Nach der Lösung der schwierigen Restitutionsfragen betont das Abkommen die Rolle der Kirche in der Bewahrung des gemeinsamen Erbes Tschechiens als Kulturnation. Ein wesentlicher Teil dieses Erbes verdankt sich dem katholischen Christentum. Der Vertrag stellt aber nicht die Freiheiten der Kirche als Institution in den Mittelpunkt, sondern bekräftigt und ermöglicht die Ausübung der Religionsfreiheit.
Auffallend ist der mehrmalige Hinweis auf das Recht der Kirche auf gleichen Zugang zu öffentlichen Finanzierungen. Dies ist indirekt als Absage an jede rechtliche Schlechterstellung der Kirche zu verstehen, wie sie gerade in vermögensrechtlichen Fragen viele Jahrzehnte lang zu beobachten war.
Wo die Kirche als Anbieterin von Seelsorgsdiensten auftritt, gilt ihre Sendung immer allen Menschen, die Zustimmung des Einzelnen vorausgesetzt. In einzelnen Punkten überschreitet der Vertrag den Horizont der katholischen Gläubigen erheblich. Art. 3 Vertrag verpflichtet die Tschechische Republik das „Recht auf Verweigerung des Militärdienstes sowie das Recht auf Verweigerung des medizinischen Dienstes aus Gewissens- oder Religionsgründen unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen“ zu garantieren.
Der Vertrag regelt wenige Details. Die Garantien beschränken sich zumeist auf das Bekenntnis, dass es diese oder jede Form freien kirchlichen Handelns geben darf. Die konkrete Regelung wird in den meisten Fragen von weitergehenden einvernehmlichen Lösungen oder gesetzliche Regelungen abhängig gemacht. Soweit es sich dabei um einseitige staatliche Anordnungen handelt, hat der Staat weite Teile der Umsetzung des Vertrages in der Hand. Die konkrete Wirksamkeit des Vertrages wird damit zu einem erheblichen Teil vom jeweiligen politischen Willen abhängen.
Eine Regelung vermögensrechtlicher Fragen fehlt. Das Restitutionsgesetz 2012 regelt die Kirchenfinanzierung nur unter dem Blickwinkel der Wiedergutmachung. Eine vertragliche Garantie anderer Mittel der Kirchenfinanzierung (Beiträge, Subventionen, Spenden, Sammlungen, Stiftungen, etc.) wäre in einem Grundlagenvertrag zu erwarten gewesen. Diese Lücke mag damit zusammenhängen, dass alle Beteiligten froh über den vermögensrechtlichen Status Quo sind. Für die Zukunft sind aber gerade in diesem sensiblen Bereich weitere Konflikte möglich.
Ebenso auffällig ist, dass eine zentrale Konkordatsmaterie völlig fehlt: Der Grundlagenvertrag enthält keine Regelungen zum Thema Schulen und Bildung. Regelungen zu konfessionellen Schulen, der Lehrerausbildung, dem Religionsunterricht und theologischen Fakultäten fehlen. Diese Lücke ist auch angesichts des grundsätzlichen Charakters des Vertrages, der in den allermeisten Fragen auf weitergehende einvernehmliche Lösungen oder gesetzliche Regelungen verweist, auffällig und relativiert die Qualifikation als Grundlagenvertrag. Es bleibt abzuwarten, ob es zu diesem zentralen Bereich der gemeinsamen Angelegenheiten von Staat und Kirche zukünftig ein Spezialabkommen geben wird können.
Trotz dieser Besonderheiten ist mit dem Vertrag ein mutiges Bekenntnis zu den Grundrechten, zum Völkerrecht und zu einem kooperativen Verhältnis von Staat und Religion gelungen, das in die Zukunft weist.
Literatur:
Tomáš Holub, Militärseelsorge in der Armee der Tschechischen Republik, https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/20070716_ethica2007_holub.pdf, [02.05.2025].
Jiří Rajmund Tretera und Záboj Horák, State and Church in the Czech Republic, in: Gerhard Robbers (Hrsg.), State and Church in the European Union, Baden-Baden 32019, 69-86.
Jan Wintr, Die Religionsfreiheit in Tschechien, OER Osteuropa Recht 64 (2018), 368-378, doi.org/10.5771/0030-6444-2018-3.
[*] Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Beitrags sah es so aus, als stünde die Ratifikation durch die Republik Tschechien unmittelbar bevor. In der Zwischenzeit hat sich diese aber unerwartet verzögert und wurde das Verfassungsgericht angerufen. Wir halten Sie über das Ergebnis auf dem Laufenden.
[1] Vgl. die Übersicht auf https://www.kooperation-international.de/laender/europa/tschechische-republik/allgemeine-landesinformationen [02.05.2025].
[2] Zur Terminologie siehe Punkt 3.
[3] Vgl. Polen: Konkordat 1993; Slowakische Republik: Konkordat 2000, ergänzt um je einen Teilvertrag zur Militärseelsorge 2002 und zum Thema Schule 2004; Ungarn: vier Teilverträge im Zeitraum 1990-2013.
[4] Nicht präjudiziert sind dadurch noch offene Ansprüche einzelner Rechtspersonen, welche bislang noch nicht abschließend geregelt worden sind.
[5] Mit dem Gesetz 3/2002 wurde die staatliche Eintragung von Religionsgemeinschaften, mit welcher der Erwerb der Rechtspersönlichkeit verbunden ist, neu geordnet. Religionsgemeinschaften, die bis dahin bereits registriert gewesen sind, genießen gegenüber den neu registrierten eine Reihe von besonderen Rechtsvorteilen, welche immer wieder Gegenstand politischer Debatten sind.
[6] Mit der Nennung der orientalischen Rechtsformen der Teilkirchenorganisation (Eparchie, Exarchie) ist indirekt die Frage beantwortet, dass der Vertrag für die gesamte Katholische Kirche in Tschechien gilt. Dies festzuhalten ist deshalb von Bedeutung, da die lateinische „Römisch-Katholische Kirche“ und die „Griechisch-Katholische Kirche“ als zwei unterschiedliche Kirchen staatlich anerkannt sind. Vgl. die Übersicht auf https://mk.gov.cz/data-registrace-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-a-svazu-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-cs-408?lang=cs [02.05.2025].
[7] Vgl. Tomáš Holub, Militärseelsorge in der Armee der Tschechischen Republik, https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/20070716_ethica2007_holub.pdf [02.05.2025].