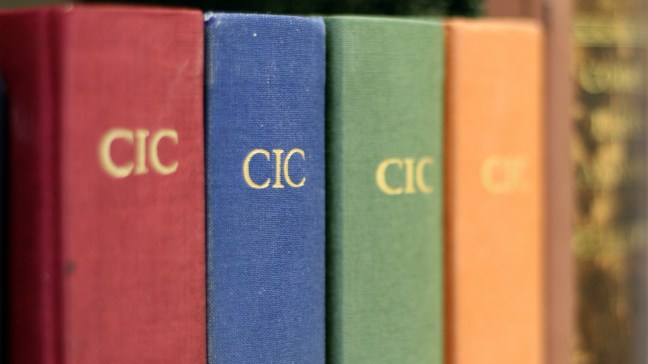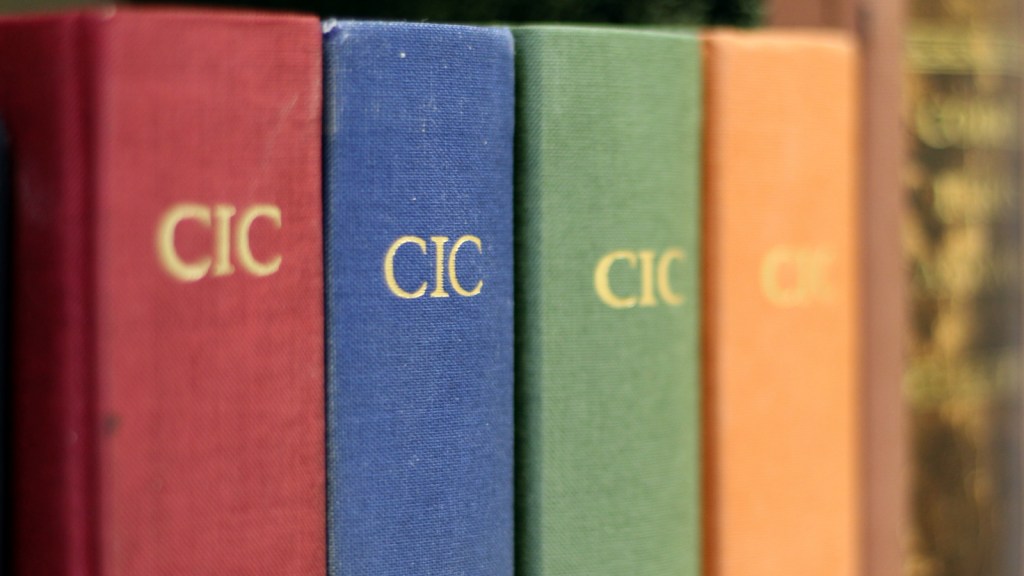DOI: 10.25365/phaidra.608
Während die rechtundreligion.at – Reihe zur Finanzierung von Religionsgemeinschaften in Europa nach und nach die einzelnen staatlichen Finanzierungssysteme vorstellen möchte, sind die nachführenden Ausführungen zum österreichischen Kirchenbeitrag an die Katholische Kirche aus der Sicht des Kirchenrechts verfasst. Der Beitrag ergänzt insofern den Beitrag Steuerwidmung für alle statt Kirchenbeitrag? Vor- und Nachteile einer „Mandatssteuer“ zur Kirchenfinanzierung.
Von der Grundpflicht aller Gläubigen zur materiellen Unterstützung ihrer Kirche
Die durch das Zweite Vatikanische Konzil vertiefte Sicht der Kirche als Gemeinschaft aller Getauften ist nicht nur der Grund, um unter dem Stichwort „Synodalität“ nach verstärkten Mitwirkungsrechten der nichtgeweihten Gläubigen zu fragen. Die in der Taufe begründeten Rechte, an der Sendung der Kirche mitzuwirken, rufen die Gläubigen auch in eine im Vergleich zu einer „Kleruskirche“ (P. M. Zulehner) stärkere Verantwortung. Das kirchliche Recht normiert daher nicht nur eine Reihe von Grund-Rechten, welche die Getauften haben, sondern fasst die Berufung aus der Taufe auch in konkrete Rechtspflichten. An deren Spitze steht c. 209 § 1 CIC, welcher die Gläubigen verpflichtet, auch in ihrem eigenen Verhalten, immer die Gemeinschaft mit der Kirche zu wahren. Ebenfalls im Katalog der grundlegenden Rechte und Pflichten aller Gläubigen des Codex des kanonischen Rechts findet sich c. 222 § 1 CIC: „Die Gläubigen sind verpflichtet, für die Erfordernisse der Kirche Beiträge zu leisten, damit ihr die Mittel zur Verfügung stehen, die für den Gottesdienst, die Werke des Apostolats und der Caritas sowie für einen angemessenen Unterhalt der in ihrem Dienst Stehenden notwendig sind.“ C. 222 § 1 CIC gibt über das konkrete Ausmaß, in welchem die Gläubigen zur materiellen Unterstützung der Kirche verpflichtet sind, keine direkte Auskunft. Dieses lässt sich annäherungsweise aus Gerechtigkeitsüberlegungen – wer viel besitzt, kann auch mehr geben; möglichst alle Vermögensarten sollen berücksichtigt werden, damit es nicht zu einer einseitigen Belastung der Arbeitnehmer: innen kommt – und aus den konkreten Erfordernissen für die Verwirklichung der Zwecke des Kirchenvermögens erschließen.
Die Pflicht der Gläubigen, ihre Kirche nicht nur mit ihrer fortdauernden Zugehörigkeit und mit ihrem Gebet, sondern auch mit materiellen Gaben zu unterstützen, ist an sich keine Besonderheit des katholischen Kirchenrechts. Jede freiwillige Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft begründet neben einer Reihe von Rechten auch Pflichten, die auf die Verwirklichung und den Bestand des Gemeinwohls ausgerichtet sind. Schon die Mitgliedschaft in einem Verein geht mit der Verpflichtung, den Vereinsbeitrag zu zahlen, einher. Nach ihrem Selbstverständnis sind die Kirchen aber gerade kein Verein, sondern Ort und Gemeinschaft der christlichen Religionsausübung. Diese bezieht sich nicht nur auf einen „Vereinszweck“, sondert betrifft den ganzen Menschen. Kirche ist, nach eigenem Selbstverständnis, daher eine Solidargemeinschaft, die sich eher mit der Familie als mit Vereinen vergleichen lässt. Weder die Familie als solche noch die einzelnen Mitglieder sucht sich alle Familienmitglieder aus. Dennoch bestehen im Wesen des Menschen verwurzelte Pflichten, füreinander zu sorgen. Dass eine hochdifferenziert strukturierte Glaubensgemeinschaft wie die Katholische Kirche nicht nur von spiritueller Nahrung leben kann, sondern für die Verwirklichung ihrer Aufgaben in unserer Welt materielle Güter braucht, ist eine Selbstverständlichkeit, deren Anerkennung keinen positiven persönlichen Standpunkt zur Religion verlangt. Nicht die Frage, ob die Gläubigen ihre Kirche finanziell unterstützen sollen, ist daher kirchenrechtlich relevant, sondern die Frage, wie sie das tun können.
Arten der Kirchenfinanzierung im Kirchenrecht
Dass die Kirche den Anspruch erhebt, Vermögen zu erwerben, dieses zu verwalten und auch wieder zu veräußern, ist daher im CIC als ein Recht, das mit dem Wesen der Kirche selbst untrennbar verbunden ist und als Anspruch korporativer Freiheit gegenüber dem Staat reklamiert wird, normiert.[1] Auf welche Weise die Kirche die Vermögenswerte erlangen kann, welche sie für die Verwirklichung ihrer eigenen Zwecke (die Durchführung des Gottesdienstes, die Sicherstellung des angemessenen Unterhalts des Klerus und anderer Kirchenbediensteter und die Ausübung der Werke des Apostolats und der Caritas) benötigt, ist nicht für die ganze Weltkirche allgemein normiert. Der Gesetzgeber hat auf eine universale Regelung aus mehreren Gründen verzichtet. So würde jede Aufzählung von Erwerbsarten die Gefahr mit sich bringen, nicht genannte als unerwünscht oder gar verboten zu betrachten. Zweitens ist die Frage der Finanzierung von Religionsgemeinschaften zumeist das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwickelung, die umso komplexer ist, je enger die Verbindung der Kultur- und Staatsgeschichte mit der Kirchengeschichte ist. Bewusste Abnabelungen des Staates von zuvor staatskirchlichen Positionen der Kirche prägten einzelne Kirchenfinanzierungssysteme genauso wie Enteignungen oder gewachsene partnerschaftliche Strukturen andere. Nicht zuletzt ist die Frage der Kirchenfinanzierung auch eine kulturelle Frage. So gibt es, weltweit betrachtet, da und dort noch Unterhaltsleistungen von Gemeindemitgliedern an den Klerus mit Naturalien. Auch mentalitätsmäßig lassen sich gravierende Unterschiede, wie weit Menschen Spenden und Mäzenatentum auch gegenüber Religionsgemeinschaften als selbstverständlich erachten, beobachten. Während in den USA öffentlich sichtbare Spenden Teil des gesellschaftlichen Anerkennungsspiels sind, ist eine Bevölkerung, die seit unvordenklicher Zeit daran gewöhnt ist, dass die Kirche sich entweder aus eigenem, bereits vorhandenem Vermögen oder durch Staatsleistungen oder auch aus einer Mischung von beidem finanziert, nicht ohne Weiteres bereit, die Finanzierung der Kirche durch freiwillige Spenden zu übernehmen. Vergleiche von konkreten Kirchenfinanzierungssystemen sind daher auch nur valide, wenn der entsprechende Kontext mitberücksichtigt wird.
Auch wenn der universale Gesetzgeber es also prinzipiell offenlässt, welche Quellen der Finanzierung die jeweils geeignetsten sind, muss im Blick auf die katholische Gesamtkirche dennoch eine gewisse Präferenz für spendenbasierte Systeme konstatiert werden. C. 1261 § 1 CIC spricht von „vermögenswerten Zuwendungen“ der Gläubigen. C. 1262 CIC überträgt der Bischofskonferenz die Zuständigkeit, eine konkrete Ordnung für „erbetene Unterstützungen“ zu beschließen.
Ein aus dem verfassungsrechtlich eingeräumten Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die über ein echtes Besteuerungsrecht ihrer Mitglieder verfügt, ist dem CIC fremd. Dies verwundert aber nicht, da eine echte „Kirchensteuer“ nur in der Bundesrepublik Deutschland und – dort aber auf gänzlich anderer rechtlicher Grundlage – in einigen Schweizer Kantonen besteht. Auch wenn die anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften auch in Österreich öffentlich-rechtlich verfasst sind, gewährt ihnen weder die Bundesverfassung noch sonstige Gesetze ein Besteuerungsrecht. Der Kirchenbeitrag ist vielmehr als Sonderform eines Vereinsbeitrags durch die eigenen Mitglieder konstruiert, welche besonderen staatlichen Regelungen unterworfen ist. Historisch wurde diese Form durch den (nationalsozialistischen) Staat bewusst auch gewählt, um die Menschen zum Kirchenaustritt zu bewegen.
Eine schematische Vorschreibung von Abgaben sieht c. 1263 CIC nur ganz ausnahmsweise in Form einer Besteuerung von kirchlichen (!) Rechtspersonen vor. Eine Steuer von anderen (natürlichen oder juristischen) Personen darf der Diözesanbischof nur im äußersten Notfall und nach Beratung mit den Kontrollgremien der diözesanen Vermögensverwaltung bestimmen. Diese universalrechtliche Regelung durchbricht derselbe Canon aber in seinem letzten Satz, indem dort „partikulare Gesetze und Gewohnheiten, die dem Bischof weitergehende Rechte einräumen“ bestehen bleiben dürfen. Diese von Kirchenrechtler:innen als „clausula teutonica (deutsche Klausel)“ bezeichnete Ausnahmebestimmung „legalisiert“ somit in erster Linie die deutsche Kirchensteuer aber auch den österreichischen Kirchenbeitrag.[2]
Der Kirchenbeitrag als gerechte Form der Finanzierung?
Auch wenn die Logik der Beitragsberechnung mehrfach zugunsten der Berücksichtigung individueller Lebenssituationen (besondere Belastungen, oftmals mangelhafte finanzielle Möglichkeiten während des Studiums…) durchbrochen ist, steht im Zentrum des heute geltenden Kirchenbeitragsrechts der Gedanke, dass weder die Höhe der Beiträge noch deren konkrete Verwendung vom Willen des einzelnen Kirchenmitglieds abhängen. Die Höhe des Beitrags steht vielmehr in einem direkten Verhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit. Diese ist freilich angesichts des ungleichen Vermögens der Kirchenmitglieder schwer objektiv feststellbar. Als Kennzahl dienen daher das steuerpflichtige Einkommen, von dem gewisse Abzüge vorgenommen werden. Da jedoch die Kirche aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Einsicht in die Steuerakten ihrer Gläubigen hat, ist sie auf Selbstauskünfte und Schätzungen angewiesen. Erstere tendieren mit hoher Wahrscheinlichkeit auch unter aktiven Kirchenmitgliedern, möglichst nach unten modelliert zu werden. Schätzungen wiederum können nur von Durchschnittswerten ausgehen, welche mitunter selbst nicht ohne Weiteres feststellbar sind. Es ist daher davon auszugehen, dass der tatsächlich vorgeschriebene Kirchenbeitrag um einiges niedriger als der theoretisch geschuldete ist.
Die einzige Möglichkeit, sich der Beitragspflicht zu entziehen, bietet der Austritt aus der Kirche nach staatlichem Recht. Dass es keine andere Möglichkeit gibt, den Beitrag zu verweigern, wird für all jene, die tatsächlich die Verbindung zur Kirche hinter sich lassen wollen, kein Problem sein. Schwierigkeiten treten auf, wenn jemand sich innerlich weiter als Katholik:in sieht und auch eine Verbundenheit zur Gemeinschaft der Gläubigen bewahren möchte. Die österreichischen Bischöfe sehen im Kirchenaustritt in jedem Fall eine so schwerwiegende Verletzung der Einheit mit der Kirche, und damit eine Verletzung der in der Taufe begründeten Mitverantwortung für die Kirche (c. 209 § 1 CIC), dass ein Empfang der Sakramente oder die Übernahme eines kirchlichen Amtes (Patenamt, Pfarrgemeinderat, etc.) nicht möglich ist. Dies ist in den meisten Fällen eine nachvollziehbare und auch logische Beurteilung, welche die freie Entscheidung des Kirchenaustritts in ihrer Tragweite für die Zugehörigkeit zur Kirche ernst nimmt. Wie aber soll mit jenen (wenigen) Personen umgegangen werden, die den Kirchenbeitrag bewusst nicht zahlen, weil sie mit ihrer Pfarre, mit ihrer Diözese, mit politischen Äußerungen dieser oder jener kirchlichen Stelle nicht einverstanden sind und zugleich einen Beitrag für Institutionen (andere Diözesen, den Apostolischen Stuhl, die Caritas, etc.) leisten? Sollte der Beitrag in etwa so hoch sein wie der geschuldete Kirchenbeitrag, dann liefe der Vorwurf, man entziehe sich der Verpflichtung das, was individuell zugemutet werden kann, zu leisten, in Leere.
Vor- und Nachteile einer Zweckwidmung des Kirchenbeitrags
In diesem Kontext, aber auch im Blick auf eine verstärkte Akzeptanz des Kirchenbeitragssystems überhaupt, besteht in einzelnen Diözesen seit vielen Jahren die Möglichkeit, einen Teil des individuell geleisteten Kirchenbeitrags für bestimmte Institutionen oder auch bestimmte Aufgabenfelder zweckzuwidmen. Diese Möglichkeit wurde nicht immer in auffallend offensiver Weise kommuniziert. Der Grund dafür dürfte sein, dass eine Zweckwidmung zumindest drei gravierende Nachteile mit sich bringt. Zum einen verliert der Diözesanbischof einen Teil jenes Entscheidungsspielraumes, den ihm das Recht für die persönlich verantwortete und in der Weihe begründete Leitung der Ortskirche überträgt. Der zweite Nachteil ist, dass wenig bekannte Institutionen kaum die Chance haben dürften, von den Gläubigen bedacht zu werden. Es besteht damit die Gefahr, dass weithin akzeptierte und bekannte Institutionen (man denke an die Caritas) stark überproportional bedacht werden, sodass andere, vielleicht auch sehr wichtige pastorale Aufgaben nicht mehr finanziert werden können. Unangemessen wäre es auch, wenn die Zweckwidmung zu einem werbemäßig unterstützten Konkurrenzkampf einzelner kirchlicher Institutionen gegeneinander führen würde. Soweit die Finanzierung der Unterhaltsleistungen für den Klerus und der Gehälter für die Mitarbeiter:innen nicht mehr gedeckt wären, würde das ganze System in Gefahr geraten. Die dritte Gefahr besteht in der Notwendigkeit, für die administrative Bewältigung der Zweckwidmungen, neues Personal einstellen zu müssen, was auf Kosten der nichtgewidmeten Teile geht und den Entscheidungsspielraum noch einmal verringert.
Die Einschränkung des bischöflichen Ermessens kann man auch positiv sehen. Die Möglichkeit der Zweckwidmung eröffnet nämlich die Möglichkeit echter Partizipation an der Leitung und steht damit im Kontext der derzeit in der Katholischen Kirche allgegenwärtigen Synodalität. Kaum ein Instrument dürfte effektiver Einfluss auf die Leitung haben als die Möglichkeit der Mitentscheidung über den Haushalt.
In die Abwägung der Vor- und Nachteile durch die österreichischen Diözesen ist in jüngster Zeit Bewegung gekommen. Zum einen besteht nunmehr in allen Diözesen die Möglichkeit der Zweckwidmung, zum anderen wird diese auch transparent kommuniziert. Damit wird wohl das doppelte Ziel verfolgt, die aktiven Gläubigen in ihrer Mitverantwortung für die Kirche zu ermächtigen und jene, die über einen Austritt aus der Kirche nachdenken, über die neue Mitbestimmungsmöglichkeit von der Sinnhaftigkeit ihres Beitrags zu überzeugen.
Für welche Institutionen der Kirchenbeitrag gewidmet werden kann, wurde in den einzelnen Diözesen unterschiedlich geregelt. Allen Diözesen gemeinsam ist die Vielfalt des Spektrums der Tätigkeitsfelder, denen sich die Begünstigten widmen. Diese reichen von unterschiedlichen Bildungsaufgaben über die Förderung von Familien, Linderung sozialer und materieller Not bis hin zu Umweltthemen. Bemerkenswert ist die in der Erzdiözese Wien bestehende Möglichkeit, die Priesterbruderschaft St. Petrus zu begünstigen. Diese ist ganz von der Spiritualität der vorkonziliaren lateinischen Liturgie geprägt und widmet sich der Seelsorge gegenüber stark traditionsverbundenen Gläubigen. Aus dieser Gruppe heraus wurde das Kirchenbeitragssystem in der Vergangenheit immer wieder als Grundlage für die Finanzierung von „zu wenig katholischen“ Anliegen infrage gestellt. Mit der Zweckwidmungsmöglichkeit ist damit klargestellt, dass sich auch diese Gläubigen ihrer Beitragspflicht nicht entziehen können, ohne die Gemeinschaft mit der Kirche zu verletzen.
Schlussbemerkung
Um die Vor- und Nachteile der Zweckwidmung möglichst auszugleichen, können bis zu 50 % des eigenen Beitrags gewidmet werden, was – absolut betrachtet – ein erheblicher Anteil ist. Die Stabilität des Finanzierungssystems wird davon abhängen, dass von der Möglichkeit nicht alle Beitragsleistenden tatsächlich Gebrauch machen. Im Gegensatz zum italienischen System der Steuerwidmung bezieht sich die Widmung ausschließlich auf den eigenen Beitrag und hat keine Auswirkungen auf die budgetäre Zuteilung der Beiträge von Gläubigen, die keine Zweckwidmung vorgenommen haben. Durch die Möglichkeit der Zweckwidmung erhalten sowohl Gläubige, die in einer Distanz zur eigenen Kirche stehen als auch Gläubige, die mit der Mittelverwendung durch die eigene Diözese unzufrieden sind, erhebliche Mitgestaltungsrechte. Die Zweckwidmung ist keine Empfehlung, sondern bindet die kirchliche Autorität. Der österreichische Kirchenbeitrag bleibt eine rein mitgliederbasierte Finanzierung von Religion und wirft daher keine Fragen der negativen Religionsfreiheit auf. Zugleich übernimmt das österreichische System mit der Zweckwidmung ein für Mandats- bzw. Kultursteuern kennzeichnendes Element. Es bleibt abzuwarten, wie die neue bzw. nunmehr auch allgemein kommunizierte Möglichkeit angenommen wird und ob durch sie sich das bisherige System des österreichischen Kirchenbeitrags verändern wird.
[1] C. 1254 CIC laute: „§ 1. Die katholische Kirche hat das angeborene Recht, unabhängig von der weltlichen Gewalt, Vermögen zur Verwirklichung der ihr eigenen Zwecke zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu veräußern.
[2] Zusätzlich garantierten auch die deutschen Konkordate und der österreichische Vermögensvertrag aus dem Jahr 1960 weite Teile des vermögensrechtlichen Status Quo in beiden Ländern.