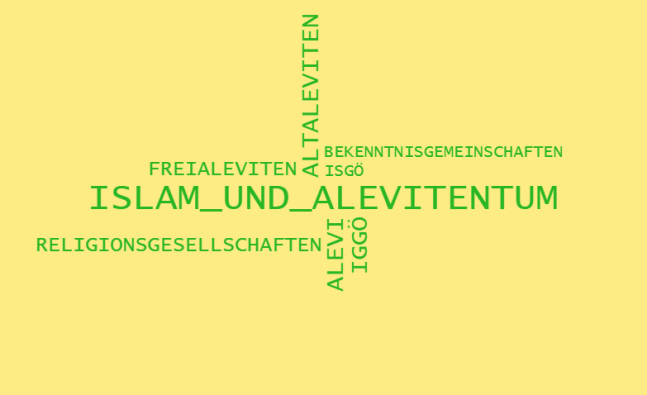DOI: 10.25365/phaidra.738
Die Finanzierung von Religionsgemeinschaften beruht in der Republik Slowenien mit ihren ca. zwei Millionen Einwohner:innen,[1] wie in den meisten anderen europäischen Staaten auf einem Mischsystem, das im Wesentlichen auf Eigenfinanzierungen, aber auch auf Finanzierungen durch den Staat aufbaut. Die staatlichen Finanzierungen können in eher direkte und überwiegend indirekte Formen unterschieden werden. Eine eigenständige Erwähnung bedarf die Frage der „Denationalierung“, d.h. der Restitution von Vermögenswerten, welche nach 1945 durch die kommunistische Staatsführung enteignet worden sind. Hier hat sich Slowenien, anders als zum Beispiel die Republik Österreich, hauptsächlich für Naturalrestitutionen entschieden, wobei es sich hier um einen überaus komplexen und – wie in den meisten Staaten, die mit der rechtlichen Aufarbeitung von Enteignungen aus der Vergangenheit befasst sind – politisch umstrittenen Komplex handelt, welcher am Ende dieses rechtundreligion.at-Beitrags nur kurz angedeutet werden kann.
1. Religionsrechtlicher Rahmen
1.1 Slowenische Verfassung
Slowenien, das nach dem Auseinanderfallen Jugoslawiens 1991 als erster Nachfolgestaat die Unabhängigkeit und Souveränität erlangt hatte, ist eine demokratische Republik. Artikel 7 der Verfassung der Republik Slowenien vom 23. Dezember 1991 sieht die Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften vor. Mit der Trennung ist die Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften ausdrücklich verbunden und ihre freie Tätigkeit garantiert. Der Gleichheitssatz (Art. 14 Verfassung Slowenien) nennt als Kriterium die Gleichheit „ungeachtet des Glaubens“.
Da die Trennung – anders als in Österreich – als ausdrückliches Verfassungsgebot normiert ist, lässt sich Slowenien auf den ersten Blick als laizistischer Staat beschreiben. Dieser Befund wird durch eine Reihe von Besonderheiten[2] bestätigt: die Trennung schließt eine Übernahme von Hoheitsaufgaben durch die Religionsgemeinschaft aus; in den öffentlichen und staatlich zertifizierten Schulen findet kein Religionsunterricht statt; die öffentliche Schule und der öffentliche Kindergarten sind weitestgehend religionsfreie Bereiche. Selbst auf Privatschulen wirkt sich der Trennungsgedanke aus, sofern diese nicht schon vor einem bestimmten Stichtag bestanden haben. Die Trennung steht allerdings der Kooperation des Staates mit den Religionsgemeinschaften dort nicht entgegen, wo eine Zusammenarbeit für die Ausübung der Religionsfreiheit notwendig ist. In einer gewissen Spannung zum Trennungsregime steht auch die Tatsache, dass der Staat auf direkte oder indirekte Weise auf gesetzlicher Grundlage Beiträge zur Finanzierung der Religionsgemeinschaften leistet. In der slowenischen Rechtswissenschaft wird die Trennung daher nicht mit der Zurückdrängung von Religion aus der Öffentlichkeit, wie es für laizistische Staaten kennzeichnend ist, begründet.[3] Die Trennung verhindert vielmehr, dass der Staat Einfluss auf die Identität und die Handlungsfreiheit der Religionsgemeinschaften nimmt. Religionsfördernde Maßnahmen liegen daher im freien Ermessen des Staates, so lange dadurch nicht einzelne Religionsgemeinschaften unsachlich bevorzugt werden. Der slowenische Verfassungsgerichtshof anerkennt die besondere Bedeutung der Religionsgemeinschaften für das Gemeinwohl, da diese durch ihre öffentliche Tätigkeit die Verwirklichung der Religionsfreiheit erst ermöglichen.[4]
Art. 41 der Verfassung garantiert die Religionsfreiheit innerhalb der umfassend normierten Gewissensfreiheit: „Das Bekenntnis des Glaubens und anderer Überzeugungen im privaten und im öffentlichen Leben ist frei“. Neben dieser positiven Religionsfreiheit ist die negative Freiheit von Religion ebenso garantiert wie das elterliche Erziehungsrecht. Das Elternrecht auf religiöse Erziehung und die persönliche Glaubens- und Gewissensfreiheit der Kinder müssen, dem jeweiligen Alter entsprechend, miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Als unabhängiger Staat ratifizierte Slowenien 1994 die EMRK. Art. 9 EMRK und alle anderen für die Ausübung der Religionsfreiheit und das Verhältnis von Religion und Staat relevanten Konventionsbestimmungen ergänzen daher den religionsverfassungsrechtlichen Rahmen.
1.2 Gesetz über die Religionsfreiheit
Eine bedeutende einfachgesetzliche Ausgestaltung erfuhr das Verhältnis zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften durch das Gesetz über die Religionsfreiheit („ZVS“) im Jahr 2007.[5] Dieses ermöglicht es religiösen Gemeinschaften, sich bereits ab der Mindestgröße von zehn (!) in Slowenien wohnhaften Mitgliedern staatlich registrieren zu lassen (Art. 14 ZVS). Mit der Registrierung erwirbt die Religionsgemeinschaft einen speziellen, privatrechtlichen Status als eine besondere Form einer freiwilligen, gemeinnützigen Vereinigung. Art. 4 ZVS bekräftigt die religionsgemeinschaftliche Autonomie und die Neutralität des Staates. Der Staat bekennt sich dort aber auch ausdrücklich zur Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften.
Der im ZVS begründete Rechtsstatus ist die Grundlage dafür, dass der Staat mit den einzelnen Denominationen Verträge schließen kann, welche Fragen von gemeinsamer Bedeutung normieren. Einen besonderen Status nimmt aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtungskraft das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl aus dem Jahr 2001[6] ein.
Für den Empfang staatlicher Finanzierungen ist die Registrierung gem. Art. 27 ZVS eine notwendige Voraussetzung. Registrierte Religionsgemeinschaften haben darüber hinaus auch besondere Rechte im Sammlungswesen.
2. Staatliche Finanzierungen
2.1 direkte Finanzierungen
Auch wenn die slowenische Verfassung die Trennung von Religionsgemeinschaften und dem Staat anordnet, existieren einige Formen direkter staatlicher Finanzierung.
a) Kofinanzierung der Sozialbeiträge für Geistliche
Art. 27 ZVS schafft die Rechtsgrundlage für die wichtigste Form der staatlichen Finanzierung von Religionsgemeinschaften. Der Staat bezuschusst durch zweckgebundene, direkte Zahlungen die Beiträge zur Pflichtversicherung in der staatlichen Sozialversicherung (Pensionsversicherung, Krankenversicherung und Invaliditätsversicherung) für die Geistlichen der registrierten Religionsgemeinschaften. Grundlage ist nicht der real gezahlte Lohn bzw. Unterhalt, sondern die durchschnittliche Beitragsgrundlage öffentlich Bediensteter. Eine Novellierung von Art. 27 ZVS im Jahr 2023 reduzierte die ursprünglich vollständig übernommene Bezuschussung in der genannten Höhe auf nur mehr 60 %.
Voraussetzung für die Bezuschussung ist, dass die von der Religionsgemeinschaft angestellte Person ausschließlich für diese tätig ist. Dass Priester und Ordensleute der katholischen Kirche keine Angestellten ihrer Kirche sind, sondern ihren kirchlichen Dienst im Rahmen religiöser Bindungszusammenhänge (Weihe und Inkardination bzw. Ordensgelübde bzw. -versprechen) erbringen, berücksichtigt Art. 27 Abs. 2 ZVS, der die Bezuschussung auf diesen, in der Praxis größten, Personenkreis ausdehnt.
Neben dem Wohnsitz und der tatsächlichen Tätigkeit in Slowenien hängt der Zuschuss noch an einer Mindestgröße. Für je 1000 Mitglieder übernimmt der Staat den Zuschuss für einen Religionsdiener.
b) Finanzierung besonderer Seelsorge
Neben der Kofinanzierung der Sozialversicherungsbeiträge finanziert der Staat teilweise auch das Personal für die Seelsorge im Zusammenhang öffentlicher Anstalten (Gefängnisseelsorge, Militärseelsorge, Polizeiseelsorge, Krankhausseelsorge). Dies geschieht auf der Grundlage der mit den einzelnen registrierten Religionsgemeinschaften geschlossenen Vereinbarungen.
c) Subvention der Erhaltung von Kulturgütern und andere Subventionen
Der Staat subventioniert die für die Erhaltung von Bauten und Kulturdenkmälern, die für das nationale kulturelle Erbe von besonderer Bedeutung sind, anfallenden notwendigen Kosten. Dabei handelt es ich formal um keine besondere Form einer finanziellen Unterstützung von Religionsgemeinschaften, da nicht die Religionsausübung gefördert werden soll, sondern der Kulturgüterschutz. Da die religiösen Bauten und religiösen Kunstschätze aber großteils im Eigentum der Religionsgemeinschaften sind, kommen die Subventionen direkt den religiösen Eigentümern zugute. Ähnliches gilt dort, wo der Staat Tätigkeiten subventioniert, welche die Religionsgemeinschaften im Bereich der sozialen Fürsorge leisten. Soweit kirchliche Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder soziale Projekte gefördert werden, erfolgt dies in gleicher Weise wie bei nichtreligiösen gemeinnützigen Organisationen.
2.2 Indirekte Finanzierungsinstrumente
Als indirekte Finanzierungsinstrumente sind vor allem Steuerbefreiungen und gewisse administrativen Erleichterungen zu nennen. Um in den Genuss der Vorteile zu kommen, ist die staatliche Registrierung erforderlich.
a) Begünstigungen im Steuerrecht
Registrierte Religionsgemeinschaften gelten als spezielle Form einer gemeinnützigen Vereinigung. Sie sind grundsätzlich von der Zahlung der Körperschaftsteuer befreit,[7] solange die Einnahmen aus ihren Haupttätigkeiten stammen bzw. diesen unmittelbar zugeordnet sind. (z. B. Spenden, Kultbeiträge, Einnahmen im Zusammenhang liturgischer Zeremonien). Soweit eine Religionsgemeinschaft ein Gewerbe in Gewinnabsicht betreibt, unterliegt sie der vollen Steuerpflicht.
Dass jene Immobilien, der der Religionsausübung dienen, keine unmittelbaren Wirtschaftsgüter sind, drückt sich in der Befreiung von der Grundsteuerpflicht und manchen kommunalen Gebühren (z.B. Müllabfuhr) aus.[8]
Auch wenn es sich um keinen Vorteil handelt, der mit dem Status einer registrierten Religionsgemeinschaft unmittelbar in Verbindung steht, da auch andere gemeinnützige juristischen Personen davon profitieren, kann man auch das Recht des Vorsteuerabzugs im Umsatzsteuerrecht in die Aufzählung der steuerlichen Begünstigungen aufnehmen.
Eine weitere indirekte Finanzierung des Staates im Steuerrecht bildet die Absetzbarkeit von Spenden an registrierte Religionsgemeinschaften bis zu einem bestimmten Prozentsatz des steuerpflichtigen Einkommens.[9]
Schließlich unterliegen Gegenstände, die für die Ausübung des Gottesdienstes eingeführt werden, einem ermäßigten Zollsatz bzw. sind überhaupt zollbefreit.[10]
b) Eine Kultursteuer light?
Die Komplexität des slowenischen Finanzierungssystems für Religionsgemeinschaften zeigt sich auch darin, dass neben den beschriebenen Finanzierungsformen die Steuerzahler:innen auch die Möglichkeit haben, 1 % (ursprünglich 0,5 %) ihrer Einkommenssteuer für bestimmte Zwecke im öffentlichen Interesse zu widmen. Dabei handelt es sich nicht um eine mit dem italienischen Otto-per-Mille-System[11] vergleichbaren Mandatssteuer, sondern um „persönliche Schenkungen der Einkommenssteuer“, welche an der insgesamt geschuldeten Steuerlast nichts verändert. Neben Parteien, Gewerkschaften und einer großen Zahl an NGOs sind auch Religionsgemeinschaften mögliche Profiteure dieser Steuerwidmungen. Letztlich handelt es sich hierbei um eine indirekte staatliche Finanzierung, da der Steuergläubiger der Staat ist, der zugunsten der begünstigten Organisationen auf einen (kleinen) Teil der Einnahmen aus der Einkommenssteuer verzichtet. Im Jahr 2022 widmeten die Steuerzahler durchschnittlich 22,11 Euro, welche auf über 6000 begünstigte Organisationen verteilt wurde.[12]
3. Private Finanzierungen
Auch wenn die aufgezählten staatlichen Instrumente der Finanzierung von Religionsgemeinschaften eine nicht unerhebliche Belastung des Staatshaushalts bedeuten, leisten private Finanzierungsquellen die wichtigsten Beiträge zur wirtschaftlichen Absicherung der Aufgaben der registrierten Religionsgemeinschaften. Durch die Registrierung werden diese vollrechtsfähig im Rahmen des slowenischen Privatrechts. Zugleich normiert Art. 29 Abs. 1 ZVS den Grundsatz der Selbstfinanzierung von Religionsgemeinschaften. Spezielle Einschränkungen, am Wirtschaftsverkehr teilzunehmen, bestehen für Religionsgemeinschaften nicht. Sie können auf jede legale Art Eigentum erwerben und veräußern. Religionsgemeinschaften können Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit erzielen und Früchte aus Vermögensveranlagungen ziehen. Eine besonders wichtige Einnahmequelle bilden Spenden und Erträgnisse von Sammlungen. Diese können anlassbezogen sein (z.B. Sammlungen im Gottesdienst) oder in regelmäßigen Beiträgen bestehen. Eine für alle Religionsgemeinschaften geltende Beschreibung ist nicht möglich. Innerhalb des allgemeinen Vereinsrechts haben auch die registrierten Religionsgemeinschaften die Möglichkeit, Beiträge von ihren Mitgliedern einzuheben. In der Katholischen Kirche erbitten die Pfarren von ihren Mitgliedern einen regelmäßigen Kultusbeitrag. Abgesehen von der steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden ist der Staat hier nicht beteiligt. Von rein privaten Spenden unterscheiden sich die Kultusbeiträge aber dann, wenn sie für die Renovierung bestimmter Kulturdenkmäler erbeten werden. Für diese Fälle besteht die Möglichkeit der staatlichen Ergänzung der Projektkosten.
4. Die „Denationalisierung“ von Eigentum
Nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens stellte sich für die neue demokratische Republik nicht nur die Frage, wie mit den nach 1945 erfolgten Enteignungen bestimmter Personengruppen (v. a. Angehörige der deutschen Volksgruppe) umgegangen werden soll. In wirtschaftlicher Hinsicht viel bedeutender erwies sich die Frage, wie weit die Überführung von Grund und Boden ins Volkseigentum (Nationalisierung) wieder rückgängig gemacht werden kann. Bereits Ende 1991 wurde mit dem „Denationalisierungs-Gesetz“[13] die rechtliche Grundlage für die Wiedergutmachung der Enteigneten geschaffen.
Der slowenische Gesetzgeber entschied sich prinzipiell für die Rückabwicklung der realen Wirtschaftsgüter, also für ein System der Naturalrestitution. Nur wo dies aus faktischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich sein sollte, wurden den Geschädigten Ansprüche auf finanzielle Entschädigung eingeräumt.
Kirchen und Religionsgemeinschaften wurden in Art. 14 DenationalisierungsG direkt als Empfänger von Restitutionen angesprochen. Allerdings wurde dort als Voraussetzung normiert, dass diese zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes auf dem slowenischen Staatsgebiet tätig sein mussten. Dies hatte vor allem für einige Einrichtungen der Katholischen Kirche die Konsequenz, dass ihnen trotz nachweisbarer Enteignungen kein Anspruch zustehen konnte. Da nicht die Katholische Kirche als ganze, sondern immer nur eine bestimmte kirchliche juristische Person Eigentümerin von Vermögenswerten sein kann – ein Umstand, der auch dem kanonischen Recht entspricht – wurde beispielsweise ein Antrag der kroatischen Erzdiözese Zagreb auf Restitution abgewiesen.[14] Auch wenn seit 1991 über 40000 Verfahren geführt wurden, konnten bis 2025 immer noch nicht alle Anträge abschließend bearbeitet werden.[15]
Diesem Beitrag liegt folgende Literatur zugrunde:
Andrej Naglič, Svoboda cerkva v Sloveniji, The Freedom of Churches in Slovenia, in Res Novae 2 (2017), 7-32, https://doi.org/10.62983/rn2865.172.1 [Anm.: übersetzt mithilfe von deepl].
Lovro Šturm / Blaž Ivanc, State and Church in Slovenia, in: Gerhard Robbers (Hg.), State and Church in the European Union, Baden-Baden 32019, 539-561.
Ana Vlahek / Matija Damjan, The Denationalisation of Agricultural Land and Forests in Slovenia: Unfolding a Decades-Long Journey, in: Journal of Agricultural and Environmental Law, XIX (2024) No. 37, 347-382, https://doi.org/10.21029/JAEL.2024.37.347.
eurel – Sociological and legal data on religions in Europe and beyond: Länderseite „Slovenia“, https://eurel.info/spip.php?rubrique64&lang=en.
[1] Aktuelle offizielle Zahlen über die Religionszugehörigkeit der Bevölkerung gibt es nicht. Die Zahlen der Volkszählung 2002 sind nicht nur veraltet, sondern aufgrund einer großen Zahl von Nichtdeklarierungen auch nicht aussagekräftig. Die letzte offizielle Statistik der katholischen Bischofskonferenz zählte für das Jahr 2022 1.480.156 Katholik:innen, was 69,92 Prozent der Bevölkerung entsprach. Vgl. https://katoliska-cerkev.si/letno-porocilo-katoliske-cerkve-v-sloveniji-2023?utm_
[2] Zu den nachfolgend aufgezählten Bereichen der Trennung von Staat und Religionen vgl. Andrej Naglič, Svoboda cerkva v Sloveniji, The Freedom of Churches in Slovenia, in Res Novae 2 (2017), https://doi.org/10.62983/rn2865.172.1 [Anm.: übersetzt mithilfe von deepl], 7-32,16.
[3] Vgl. Andrej Naglič, Svoboda cerkva v Sloveniji, 17.
[4] Vgl. ebd.
[5] Zakon o verski svobodi, Uradni list RS 14/07; zuletzt geändert durch Uradni list RS 102/2023.
[6] Ratifiziert am 28.05.2004, veröffentlicht u.a. im Kundmachungsorgan des Heiligen Stuhls, den Acta Apostolicae Sedis: AAS 103 (2011) 519-527.
[7] Vgl. Art. 59f. slowenisches KöStG.
[8] Diese Vorteile sind freilich politisch umstritten. Vgl. die interreligiöse Stellungnahme vor der Erlassung des geltenden Gesetzes zur Grundsteuer, welches Ausnahmen für religiös genützte Liegenschaften enthält: A Declaration by the Council of Christian Churches and the Islamic Community in the Republic of Slovenia regarding the Property Tax Law and the Freedom of Religion Law, 30.09.2013, http://en.katoliska-cerkev.si/a-declaration-by-the-council-of-christian-churches-and-the-islamic-community-in-the-republic-of-slovenia-regarding-the-property-tax-law-and-the-freedom-of-religion-law?utm_.
[9] Vgl. Art. 142 ff. slowenisches EStG.
[10] Vgl. https://cof.org/sites/default/files/Slovenia-ia.pdf.
[11] Sieh https://rechtundreligion.at/2024/07/15/steuerwidmung-fur-alle-statt-kirchenbeitrag-vor-und-nachteile-einer-mandatssteuer-zur-kirchenfinanzierung/ hier auf rechtundreligion.at.
[12] https://www.cnvos.si/en/ngo-sector-slovenia-arhiv/personal-income-tax-donations/.
[13] Zakon o denacionalizaciji, Uradni list RS 27/1991.
[14] Dieses Verfahren ging bis zum EGMR und erlangte dadurch eine Bedeutung für die Beurteilung der Menschenrechtskonformität von rechtlichen Voraussetzungen für die Restitution langer zurückliegender Enteignungen auch außerhalb Sloweniens. Vgl. EGMR 4, Nadbiskupija Zagrebačka v. Slovenia, 27.05.2004, Rs. 60376/00. Der Gerichtshof gesteht dort den Mitgliedstaaten einen weiten Gestaltungspielraum zu. Obwohl die Tätigkeiten der Erzdiözese Zagreb auch (geringe) Bezüge zu Slowenien aufweist, hatte die Klage keinen Erfolg.
[15] Vgl. den Bericht auf: https://sloveniatimes.com/40158/denationalisation-still-ongoing-three-decades-on.